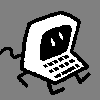
Direktwerbung im Internet: Wettrüsten im Werbekrieg
von Ludwig Siegele
In den elektronischen Briefkästen sammelt sich massenhaft Reklame
- und die Empfänger setzen sich immer heftiger zur Wehr. Hat die Direktwerbung
im Internet eine Zukunft? Steven Faulkner ist schon mehrere Tode gestorben
- virtuelle, versteht sich. Gleich dreimal wurde er im vergangenen Jahr
"terminiert", also von heute auf morgen vom Internet abgekoppelt.
Zuletzt machte der Telekomkonzern Sprint mit ihm kurzen Prozeß. "Die
haben mich nicht mal gewarnt", klagt der Chef der Integrated
Media Promotion Corporation (IMPC) in San Francisco.
Selbst wenn er gerade einen Internet-Anschluß hat, kann Faulkner kein ruhiges Leben führen. Kaum ein Tag vergeht ohne böse Anrufe von aufgebrachten Netzbürgern. Oft schicken sie ihm auch eine Mailbombe in sein elektronisches Postfach, einen riesigen Schwall von Daten, der seinen Computer lahmlegen soll. Kürzlich klopfte sogar ein zu allem bereiter Netzaktivist an seine Haustür.
Der Grund für die getriebene Existenz: Faulkners Firma verschickt täglich Millionen elektronischer Werbesendungen, im Online-Jargon spam genannt. Und spammer wie er sind die derzeit wohl meistgehaßten Wesen im Netz. "Wir sind Freiwild", sagt Faulkner nicht ohne Stolz, "manche würden uns am liebsten lynchen."
Die Reaktionen sind verständlich. Viele Netzbewohner müssen jeden Tag dutzendweise elektronische Werbesendungen aus ihrem Briefkasten löschen. Beim Online-Dienst AOL macht Netzreklame bereits ein Drittel der rund fünfzehn Millionen E-Mails aus, die dort täglich eingehen.
Kein Wunder, daß spam in der Netzwelt derzeit das große Thema ist. "Es geht schlichtweg darum, ob E-Mail ein nützliches Kommunikationsmedium bleibt", erklärt Ray Everett-Church, Sprecher der Coalition Against Unsolicited Commercial E-Mail (CAUCE), der führenden Antispam-Organisation.
IMPC-Chef Faulkner kann die ganze Aufregung nicht verstehen. "Seit wann ist es denn in Amerika ein Verbrechen, etwas verkaufen zu wollen", meint der ehemalige Immobilienhändler, der sich auf der Web-Seite seiner Firma mit Sonnenbrille und einem Bündel Dollarnoten präsentiert. Sein Werbespruch: "Spamming for Gold".
Faulkner selber verschickt gar keine Massensendungen. Er betreibt sozusagen nur das Postamt. Für 125 Dollar im Monat kann sich jedermann bei ihm einmieten und bis zu 100 000 E-Mails täglich verschicken. Wer mehr will, dem richtet der IMPC-Chef gerne für einige tausend Dollar einen eigenen Netzrechner ein.
Die Nachfrage ist so groß, daß Faulkner kaum noch nachkommt. Jede Woche muß er vier bis fünf solche Rechner installieren. So ist seine Firma mittlerweile zu einem der größten Werbeverteiler der Netzwelt geworden: Sein gut gesichertes Rechenzentrum kann täglich maximal fünfzig Millionen E-Mails ins Internet pumpen.
Faulkner freut sich über die Entwicklung und nicht nur aus Eigeninteresse, wie er versichert: "Für kleine Firmen ist das Web bisher vor allem deshalb ein Reinfall, weil sie sich dort keine Werbung leisten können. Wir helfen ihnen jetzt, Geld zu verdienen. Spam ist der große Gleichmacher."
Ganz so unschuldig, wie Faulkner vorgibt, ist seine Branche freilich nicht. Am harmlosesten ist noch der Inhalt der elektronischen Werbepost. Der Diät-Durchbruch des Jahrhunderts! Millionär durch neues Marketing-Programm! Haarwuchsmittel beseitigt auch die hartnäckigste Glatze! Wer auf solche altbekannt halbseidenen Angebote eingeht, ist selber schuld.
Kettenbriefe sind besonders geeignet für das Medium. "Dies könnte der wichtigste Brief des Jahres für Sie sein", beginnt ein neueres Exemplar, um dann auf bekannte Weise fortzufahren: "Schicken Sie bitte einen Dollar an folgende sechs Adressen, streichen Sie die erste, und hängen Sie Ihre an ..." Nur werden damit dann nicht nur zehn Freunde belästigt, sondern Tausende Unbekannter.
Beliebt ist auch spam als Werbung für spam-Software. Ein Unternehmen namens Internet Marketing bietet einen "E-Mail Blaster" an. Für 49,95 Dollar bekommen Käufer ein Programm, das 13 000 Werbesendungen pro Stunde verschicken kann. Und als Zugabe können sie sich mehr als 25 Millionen E-Mail-Adressen beim Web-Dienst des Anbieters herunterladen.
Schon weniger amüsant ist, wie solche Listen zustande kommen. Spezielle Suchsoftware "erntet" die Adressen vollautomatisch an öffentlich zugänglichen Plätzen im Netz: in den Diskussionsforen, auf persönlichen Web-Seiten oder in den Plauderecken der Online-Dienste. Wer im Internet irgendwo seine E-Mail-Adresse preisgibt, muß damit rechnen, daß sie früher oder später auf den Listen kommerzieller Datenhändler auftaucht. Das relativ strikte deutsche Datenschutzgesetz zählt im internationalen Netz wenig.
Es ist meist unmöglich, sich von solchen Listen wieder streichen zu lassen. Zwar erwähnen viele Werbebriefe diese Möglichkeit. Aber wer es versucht und die vorgeschriebene Nachricht an den Absender schickt, bekommt sie meist als unzustellbar zurück. Denn dessen Adresse ist meist gefälscht - aus Angst vor Vergeltungsaktionen. Die angepriesenen Wunderwaren kann man deswegen meist auch nicht per E-Mail bestellen, sondern nur per Fax oder bei einer Postfachadresse.
Solche Praktiken erzürnen Peter Cummings, so zumindest sein Online-Name. Er lobte öffentlich tausend Dollar für jeden aus, dem es gelingt, den besonders verhaßten Massenversender Cyber Promotions für mindestens eine Woche lahmzulegen. Im März 1997 nahm ihn offenbar jemand beim Wort: Hacker brachen in den Netzrechner der Firma ein und löschten massenweise E-Mails und andere Daten.
Passionierte Gegner des Werbemülls scheuen keine Mühen, seine Urheber ausfindig zu machen. Der erste Schritt ist in der Regel eine Beschwerde beim Internet-Anbieter des Übeltäters mit der Forderung, solchen Kunden sofort zu kündigen - was auch oft geschieht, da deren Methoden gegen die Geschäftsbedingungen der meisten Provider verstoßen.
Die Spezialität des Dienstes Junkbusters ist die Formulierung von Protestdepeschen an die Versender selbst. Diese Texte, die per Einschreiben mit Rückantwort zugestellt werden, sind nicht nur ein Ventil für Aggressionen: Der Absender bietet an, künftig alle Werbepost hinzunehmen gegen eine Gebühr von je zehn Dollar. Zitat: "Schicken Sie eine weitere E-Mail an mich, gilt das Angebot als akzeptiert."
Wie die Werbeleute haben auch ihre Gegner mittlerweile ihre eigenen Programme entwickelt, um die Plagegeister zu verfolgen. Spam Hater heißt das umfassendste: Es stellt nicht nur automatisch den Absender fest, es füllt auch gleich einen bösen Formbrief an ihn aus, und auf Wunsch ermittelt es den zuständigen Mitarbeiter bei dem betroffenen Internet-Anbieter. Weniger aufregend, aber dafür wirksamer sind E-Mail-Filter. Mehrere Online-Unternehmen bieten mittlerweile einen solchen Service: AOL etwa löscht automatisch alle Massenpost von einschlägigen Absendern, es sei denn, ein Abonnent legt ausdrücklichen Wert darauf, sie zu empfangen.
Auch flexiblere Filter kommen langsam auf den Markt. Die kleine kalifornische Softwarefirma E-Scrub bietet seit kurzem das Programm DeadBolt an. Es sitzt zwar zentral auf dem Netzrechner eines Internet-Anbieters, aber jeder Kunde kann individuell einstellen, von wem er keine Post mehr empfangen will.
Besonders allergischen Netzbewohnern erlaubt das Programm sogar, sämtliche Werbepost zu blockieren - dann sind sie allerdings auch schwerer erreichbar: Der Anwender gibt an, von welchen Adressen er Post akzeptiert. Alle anderen E-Mails werden an den Absender mit der Bitte zurückgeschickt, sie doch mit einem Paßwort in der Betreffzeile erneut zu senden. Wenn ein Absender darauf eingeht, läßt die Software die Sendung durch. Ein Massenversender wird sich jedoch kaum die Mühe machen - wenn er die automatische Rückantwort überhaupt bekommt.
Alle Filter haben jedoch Nachteile: Sie sind nie perfekt, und ihre Aktualisierung ist aufwendig. Für Ray Everett-Church sind sie denn auch eine Scheinlösung. "Sie ändern nichts an der ökonomischen Dynamik, die das Geschäft mit der elektronischen Werbepost treibt", meint der CAUCE-Sprecher. Die Absender zahlten nur einen Bruchteil der verursachten Kosten - ähnlich einer Fabrik, die ungestraft die Luft verpestet.
Für 10 Dollar, schätzt Everett-Church, kann man 100 000 Werbesendungen verbreiten. Wer darin eine "geniale Geschäftsidee" für 25 Dollar anbietet, macht schon einen guten Schnitt, wenn auch nur ein einziger Verbraucher auf das Angebot hereinfällt.
Bei den Empfängern sieht die Rechnung anders aus. Sie verlieren Zeit beim Herunterladen und zahlen oft zusätzliche Gebühren. Die meisten Kosten fallen aber bei den Internet-Anbietern an: Sie müssen zusätzliche Server aufstellen, um mit den Massensendungen fertig zu werden, und sich dann auch noch mit den Beschwerden ihrer Kunden herumschlagen.
Um diese Schieflage auszugleichen, hat CAUCE im Kongreß einen radikalen Gesetzentwurf angeregt: Wie schon die Werbung per Fax soll auch kommerzielle E-Mail verboten sein, wenn der Empfänger sie nicht vorher verlangt hat. Wer dennoch elektronische Werbepost bekommt, soll das Recht haben, beim Absender 500 Dollar pro Sendung einzuklagen.
Der Faxplage der achtziger Jahre, meint Everett-Church, habe diese Regelung weitgehend ein Ende gesetzt - vor allem, weil mehrere eigens gegründete Agenturen das Strafgeld im Auftrag der Verbraucher eintreiben.
Die Gesetzesinitiative hat heftige Diskussionen in Washington ausgelöst. Massenversender wie Faulkner oder Cyber Promotions unterstützen einen Alternativentwurf, nach dem sich die werbefeindlichen Verbraucher auf eine Liste setzen lassen müssen, um künftig verschont zu werden.
In Deutschland gibt es eine solche Liste schon: Nach dem Vorbild der Robinson-Liste, die vor unerwünschter Werbung im realen Briefkasten schützen soll, ist jetzt die eRobinson-Liste eingerichtet worden. Daß alle Plagegeister diese Liste respektieren werden, ist jedoch illusorisch.
Vielleicht findet sich ja doch noch eine technische Lösung für das Problem. Online-Experten denken schon ernsthaft darüber nach, in der Netzwelt "Aufmerksamkeitsprämien" einzuführen: Die Adressaten sollen dafür bezahlt werden, daß sie Werbepost akzeptieren.
Einige Unternehmen sind schon auf dem Weg dahin. Bei NetCreations kann man sich auf Verteilerlisten für spezielle Produkte setzen lassen. Bei Hotmail bekommt man eine kostenlose E-Mail-Adresse, wenn man über sich Auskunft gibt und die Werbung, die dann auf einen persönlich zugeschnitten wird, auch anschaut.
Am weitesten in diese Richtung geht das kalifornische Unternehmen Cybergold: Es bezahlt seine Abonnenten dafür, daß sie sich ausführlich mit der Werbung in seinem Web-Dienst beschäftigen. Pro Anzeige gibt es meist einen halben Dollar. Wer genug Geld angesammelt hat, kann es sich auszahlen lassen - oder es einem guten Zweck spenden.
(C) DIE ZEIT 12.09.1997 Nr.38
(c) beim Autor/DIE ZEIT. All rights reserved
(c) beim Autor/DIE ZEIT. All rights reserved
